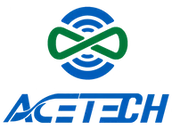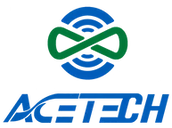
Anfrage
Festlegung eines 100-GWh-Energiespeicherziels bis 2030: Ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen Energiezukunft
Beschleunigung des Energiespeichermarktes
Ein klares Ziel für die Energiespeicherung gilt als entscheidend für die Energiewende und die Stärkung der nationalen Energiesicherheit. Branchenexperten schlagen ein gesetzliches Ziel vor, bis 2030 eine Batteriespeicherkapazität von mindestens 100 Gigawattstunden (GWh) zu erreichen – etwa das Vierfache des aktuellen Niveaus.
Jüngsten Daten der nationalen Energiebehörden zufolge werden bis Mitte 2025 rund 2,2 Millionen stationäre Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von rund 23 GWh installiert sein. Dieses schnelle Wachstum unterstreicht die strategische Rolle, die groß angelegte Energiespeicher für den Ausgleich von Angebot und Nachfrage in erneuerbaren Energiesystemen spielen.
Die wachsende Bedeutung von Batteriespeichersystemen
Batteriespeichersysteme sind für die Zukunft einer sauberen Energieinfrastruktur unverzichtbar. Sie reduzieren den Bedarf an Reservekraftwerken, senken den Netzausbaubedarf und minimieren die Drosselung der Solar- und Windenergieerzeugung. Durch die Stabilisierung der Strompreise und die Überbrückung von Stromengpässen in Zeiten geringer Produktion erhöhen Energiespeicher die Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit erneuerbarer Energien.
Diese Vorteile machen die Energiespeicherkapazität zu einer zentralen Säule beim Aufbau eines nachhaltigen, flexiblen und kostengünstigen Energiesystems, das sowohl den Verbrauchern als auch der Wirtschaft zugutekommt.
Beseitigung von Barrieren und Stärkung der politischen Unterstützung
Um das Potenzial der Energiespeicherung in Deutschland voll auszuschöpfen, sind die politischen Entscheidungsträger dringend aufgefordert, regulatorische Engpässe zu beseitigen und die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Energieinfrastruktur zu modernisieren.
Branchenumfragen zeigen, dass rund zwei Drittel der Unternehmen im Batteriespeichersektor die Beschleunigung und Vereinfachung des Netzanschlussprozesses priorisieren. Weitere wichtige Forderungen sind die Ausweitung der Netzentgeltbefreiung für Speicheranlagen und die Definition klarer Mehrzweckregeln, die den Betrieb von Systemen sowohl mit erneuerbaren als auch mit konventionellen Energiequellen ermöglichen.
Diese Verbesserungen würden es Projektentwicklern erleichtern, Speicherprojekte online zu bringen und zu den nationalen Zielen der Energiewende beizutragen.
Verbesserung der Transparenz und Projektplanung
Die Branche unterstützt die Einführung vorläufiger Netzanschlussinformationen, um die Transparenz zu erhöhen und die Projektentwicklung zu optimieren. Dieser Ansatz ermöglicht es Entwicklern von Energiespeichern, die Netzkapazität vor der Einreichung formeller Anträge zu bewerten, was Zeit und Verwaltungsaufwand reduziert.
Experten empfehlen zudem verbindliche Reservierungsmechanismen, die die Netzkapazitäten je nach Projektfortschritt zuteilen. Solche Maßnahmen würden das Vertrauen in Investitionen stärken und verhindern, dass Netzkapazitäten durch inaktive Projekte blockiert werden.
Digitalisierung und regulatorische Innovation
Weitere Fortschritte bei der Digitalisierung im Energiesektor werden als unerlässlich erachtet. Standardisierte Zeitpläne, automatisierte Genehmigungssysteme und Strafen bei Verzögerungen können Netzanschlussprozesse schneller und transparenter machen.
Darüber hinaus fordern Experten eine rasche Umsetzung der bereits in den nationalen energiepolitischen Rahmenbedingungen verankerten Bauprivilegien für große Batteriespeicher. Diese gesetzlichen Neuerungen würden den Ausbau beschleunigen und die Wettbewerbsfähigkeit der Speicherbranche stärken.
Aufbau einer belastbaren und nachhaltigen Energiezukunft
Die Festlegung eines Energiespeicherziels von 100 GWh bis 2030 würde nicht nur technologische Innovationen vorantreiben, sondern auch die Energiezuverlässigkeit in einem zunehmend auf erneuerbaren Energien basierenden System gewährleisten. Durch die Abstimmung von Energiespeicherpolitik, digitaler Infrastruktur und regulatorischer Unterstützung kann das Land die Flexibilität seines Energiesystems stärken und langfristigen wirtschaftlichen Mehrwert schaffen.
Mit koordinierten Maßnahmen, klaren Zielen und starkem Engagement der Industrie kann die Energiespeicherung im großen Maßstab zu einem Eckpfeiler der globalen Umstellung auf eine nachhaltige Energiezukunft werden.
Bei Fragen steht Ihnen unser Experte gerne zur Verfügung!