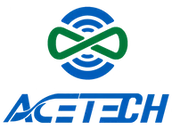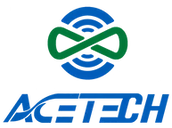
Anfrage
Fortschritte bei der Solarthermie in der Fernwärme: Nur geringes Wachstum im Jahr 2024
Im vergangenen Jahr 2024 wurden in Deutschland drei große solarthermische Kraftwerke in Betrieb genommen. Dazu gehörten Solarthermieanlagen für Fernwärme in Ammerbuch-Breitenholz in Baden-Württemberg mit einer Leistung von 1,4 MW, die von 2.045 m² Vakuumröhrenkollektoren erzeugt wurden. Im thüringischen Sondershausen entstand eine Anlage mit 4,3 MW Leistung, die von 6.086 m² Hochtemperatur-Flachkollektoren unterstützt wurde. In Häusern in Baden-Württemberg schließlich entstand eine Anlage mit 1,2 MW Leistung, die von 1.733 m² Vakuumröhrenkollektoren angetrieben wurde.
Einem zusammengefassten Update vom März 2025 zufolge gibt es in Deutschland 61 Solarthermienetze. Diese verfügen zusammen über eine Bruttokollektorfläche von 173.275 m2, was einer Solarleistung von 121 MW entspricht. Aktuell liegen Aufträge für 16 weitere große Solarthermieanlagen vor. Einige davon befinden sich bereits in der Bauphase, darunter ein Parkhausdach in Regensburg und eine Solarthermie-Dorfanlage im hessischen Bracht. Stralsund baut eines der größten Solarthermiekraftwerke, während die Leipziger Stadtwerke Deutschlands derzeit größte Solarthermieanlage errichten. Auch in Bad Rappenau, Steyerberg und Tübingen befinden sich große Solarthermieanlagen in Planung bzw. im Bau.
Erwartungen für 2026: Solarthermie in der Fernwärme verdoppelt Diese Solarthermieanlagen werden nach ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2026 voraussichtlich zusätzliche 135 MW Solarthermieenergie einspeisen und damit die installierte Gesamtkapazität im Vergleich zu 2024 deutlich mehr als verdoppeln.
Dieser Ausbau der solaren Fernwärme reicht jedoch nicht aus. Um die Wärmewende zu ermöglichen, ist eine deutliche Beschleunigung der Projektplanung und -genehmigung notwendig. Die genannten Solarthermieanlagen erfordern lange administrative Vorlaufzeiten, die größtenteils für die Suche nach geeigneten Grundstücken, die Schaffung von Baurechten und die Einholung von Genehmigungen aufgewendet werden.
Der Prognosebericht „Zukunft der Fernwärme“ legt nahe, dass es sinnvoll wäre, bis 2045 jährlich vier Terawattstunden Wärme durch Solarthermie im deutschen Fernwärmemix bereitzustellen. Dies entspricht etwas mehr als zwei Prozent des deutschen Wärmebedarfs für Wärmenetze, würde aber einer Wärmeleistung von rund sieben Gigawatt entsprechen. Um dies zu erreichen, müssten jährlich rund 500.000 Quadratmeter Bruttokollektorfläche für Solarthermie in Betrieb genommen werden.
Politische Rahmenbedingungen bleiben unsicher: Ob Hamilton die abgeschlossene Wärmeplanung mit Solarthermie als Wärmenetzversorger zügig umsetzen kann, hängt maßgeblich von den politischen Rahmenbedingungen der kommenden Bundesregierung und der Ausgestaltung der notwendigen Investitionsförderung ab. Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) steht derzeit nur bis September 2028 zur Verfügung.
Die Umsetzung der europäischen Richtlinie RED III erfolgt in der kommenden Legislaturperiode. Um den Ausbau erneuerbarer Energien deutlich voranzutreiben, muss die Bundesregierung sogenannte Beschleunigungszonen in das deutsche Planungsrecht integrieren. Erste Entwürfe zeigen drastische Änderungen in der örtlichen Bauleitplanung, die den Bau von Solarenergieinfrastrukturen und Wärmespeichern auch ohne Bebauungspläne ermöglichen könnten. Die neuen Flächentypen „Solarenergiefläche“ und „Beschleunigungsfläche“ (neue Bauordnung §§ 249b und c) könnten das Baurecht in der Bauleitplanung für Kommunen vereinfachen und den Bau großer Solarthermieanlagen für Wärmenetze deutlich erleichtern, wenn Kommunen dieses neue Planungsinstrument nutzen.
Außereuropäische Trends: Konzentrierte Solarthermie (CST) International wird die konzentrierte Solarthermie (CST) auch außerhalb Europas zunehmend genutzt. CST nutzt üblicherweise gekrümmte Parabolspiegel, die der Sonnenbahn folgen. Dieses System ermöglicht es den Kollektoren, sich von der Sonne abzuwenden oder ihr zu folgen und so die Energiezufuhr bedarfsgerecht anzupassen. Die erzeugte Wärme kann je nach Kollektortechnologie zwischen 50 und 800 Grad Celsius variieren und eignet sich daher ideal für Wärmenetze oder industrielle Prozesswärme.
Weitere Informationen zu CST-Technologien und ihren potenziellen Anwendungen finden Sie im Workshop „Zukunft konzentrierender Solarthermiesysteme“, der am 20. Mai 2025 im Rahmen des Symposiums Zukunft Wärme in Kloster Banz stattfindet. Dieser Workshop wird vom Forschungsprojekt ProSolNetz organisiert, an dem Solites beteiligt ist.
Bei Fragen steht Ihnen unser Experte gerne zur Verfügung!