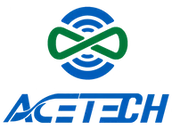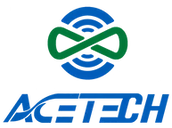
Anfrage
Branchenverband fordert Klärung bei der Regulierung von Solarspitzen
Die letzten Monate brachten wertvolle Erfahrungen für Installations- und Elektrounternehmen, die mit der neu eingeführten SolarspitzenregulierungBranchenvertreter berichten jedoch, dass viele Fragen zur praktischen Anwendung der Regeln offen bleiben. Um diese Fragen zu beantworten, hat ein Berufsverband seine Bedenken und Empfehlungen in einem Positionspapier zusammengefasst, das dem zuständigen Ministerium vorgelegt wurde. Die wichtigsten Problembereiche betreffen vor allem unkontrollierte Photovoltaikanlagen (PV) mit Leistungen unter 25 kWp.
Neues Gesetz begrenzt Wirkleistungseinspeisung für PV-Anlagen
Die Solarspitzenregulierung, die im Februar 2025 in Kraft trat, zielt darauf ab, starke Strompreisrückgänge durch übermäßige Solarstromerzeugung in Zeiten hoher Produktion zu verhindern. Die Richtlinie verlangt, dass PV-Anlagen im Rahmen der laufenden Einführung intelligenter Zähler. Kleine Plug-in-Balkonanlagen mit Wechselrichterleistungen bis 800 Watt sind von der Regelung ausgenommen. Für Anlagen über 7 kWp gilt jedoch intelligente Messsysteme und Steuergeräte sind obligatorisch.
Bis dieser Rollout abgeschlossen ist – ein Prozess, der laut Experten beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen kann – müssen neue PV-Systeme ihre Wirkleistungseinspeisung bis zu 60 Prozent ihrer Nennkapazität.
Unterschiedliche Interpretationen bei Installateuren und Netzbetreibern
Obwohl der Industrieverband die neue Regelung während der Konsultationsphase unterstützte, sind seitdem Unterschiede in der Auslegung aufgetreten zwischen Installateure und Netzbetreiber bei der Umsetzung. Das komplexe regulatorische Umfeld lässt selbst erfahrene Fachleute oft hinsichtlich der Compliance-Anforderungen im Unklaren. Diese Verwirrung erhöht das Risiko, dass installierte Systeme später technische Anpassungen benötigen, was zu Mehrkosten für die Betreiber und möglichen Rechtsstreitigkeiten zwischen Kunden und Installateuren führt.
Um auf diese Probleme aufmerksam zu machen, hat der Verband eine Positionspapier und fordert von den Behörden mehr Klarheit und Konsistenz.
Energiespeichersysteme fälschlicherweise als „fiktive Anlagen“ klassifiziert
Eines der umstrittensten Themen betrifft Batteriespeichersysteme die ausschließlich mit Solarstrom betrieben werden. Einige Netzbetreiber klassifizieren solche Anlagen angeblich als „fiktive Anlagen“ und unterwerfen sie damit der gleichen Einspeisebegrenzung von 60 Prozent wie die dazugehörigen PV-Generatoren. Branchenvertreter argumentieren, diese Auslegung halte Anlagenbesitzer davon ab, Batterien hinzuzufügen, obwohl Energiespeicherung ist ein wichtiges Werkzeug für Ausgleich der Netzlast und erfassen Solarproduktionsspitzen während der Mittagsstunden.
Um eine breitere Nutzung von zu fördernSolar-BatteriespeicherExperten empfehlen, die 60-Prozent-Grenze explizit nur auf Stromerzeugungsanlagen anzuwenden – nicht auf angeschlossene Speichersysteme.
Regulatorische Unsicherheit im Zusammenhang mit der Speichererweiterung
Sinkende Preise für BatteriemoduleViele PV-Besitzer denken über die Erweiterung bestehender Speichersysteme nach. Die Regeln für solche Erweiterungen sind jedoch weiterhin unklar. Branchenfeedback zufolge könnte die Aufrüstung eines Speichersystems den Bestandsschutz aufheben, was Unsicherheit hinsichtlich der Konformität schafft und sinnvolle Upgrades verhindert. Um dies zu vermeiden, empfehlen Experten, den Rechtsschutz für bestehende Systeme aufrechtzuerhalten, die moderater Kapazitätsausbau.
Notwendigkeit einheitlicher Regeln zur Systemkontrolle
Ein weiterer unklarer Bereich betrifft die Steuerungsanforderungen für PV-Anlagen nach der neuen Verordnung. Installateure müssen sicherstellen, dass Kundenanlagen verschiedene, teilweise widersprüchliche Rechtsvorschriften einhalten. Die überarbeiteten Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) verpflichten Anlagenbesitzer, die Steuerung von Einspeiseleistung, ermöglicht Eigenverbrauchsoptimierung – eine Funktion, die in der Branche allgemein begrüßt wird.
Die bestehenden Netzmanagementregeln im Rahmen der separaten Energiegesetzgebung beziehen sich jedoch weiterhin auf die Steuerung von Stromerzeugung, nicht Einspeisung. Diese Diskrepanz bedeutet, dass bei Netzinterventionen die Leistung von PV-Anlagen möglicherweise vollständig gedrosselt wird, wodurch die Eigentümer ihren selbst erzeugten Strom nicht mehr nutzen können und gezwungen sind, Strom aus dem Netz zu kaufen. Solche Inkonsistenzen schaffen Unsicherheit in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit von PV-Investitionen und erschweren die Systemplanung und -installation.
Forderung nach klaren, einheitlichen Richtlinien
Um Klarheit für alle Netzbetreiber zu schaffen, empfiehlt der Branchenverband einheitliche nationale Richtlinien Regelung der Steuerbarkeit von PV-Anlagen. Diese Regeln, so schlägt sie vor, sollten sich ausschließlich auf Einspeiseleistung, wie im Erneuerbare-Energien-Gesetz vorgesehen, und nicht auf die Gesamterzeugung.
Der Verband betont, dass vereinfachte Regelungen nicht nur die Rechtssicherheit für Unternehmen und Verbraucher erhöhen, sondern auch das Vertrauen in die Energiewende stärken würden. Vereinfachte Verwaltungsverfahren und die Klärung technischer Anforderungen würden dazu beitragen, den Einsatz von zu beschleunigen.Solarenergie und Energiespeichersysteme und sorgt so für einen reibungsloseren Weg in eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Energiezukunft.
Bei Fragen steht Ihnen unser Experte gerne zur Verfügung!